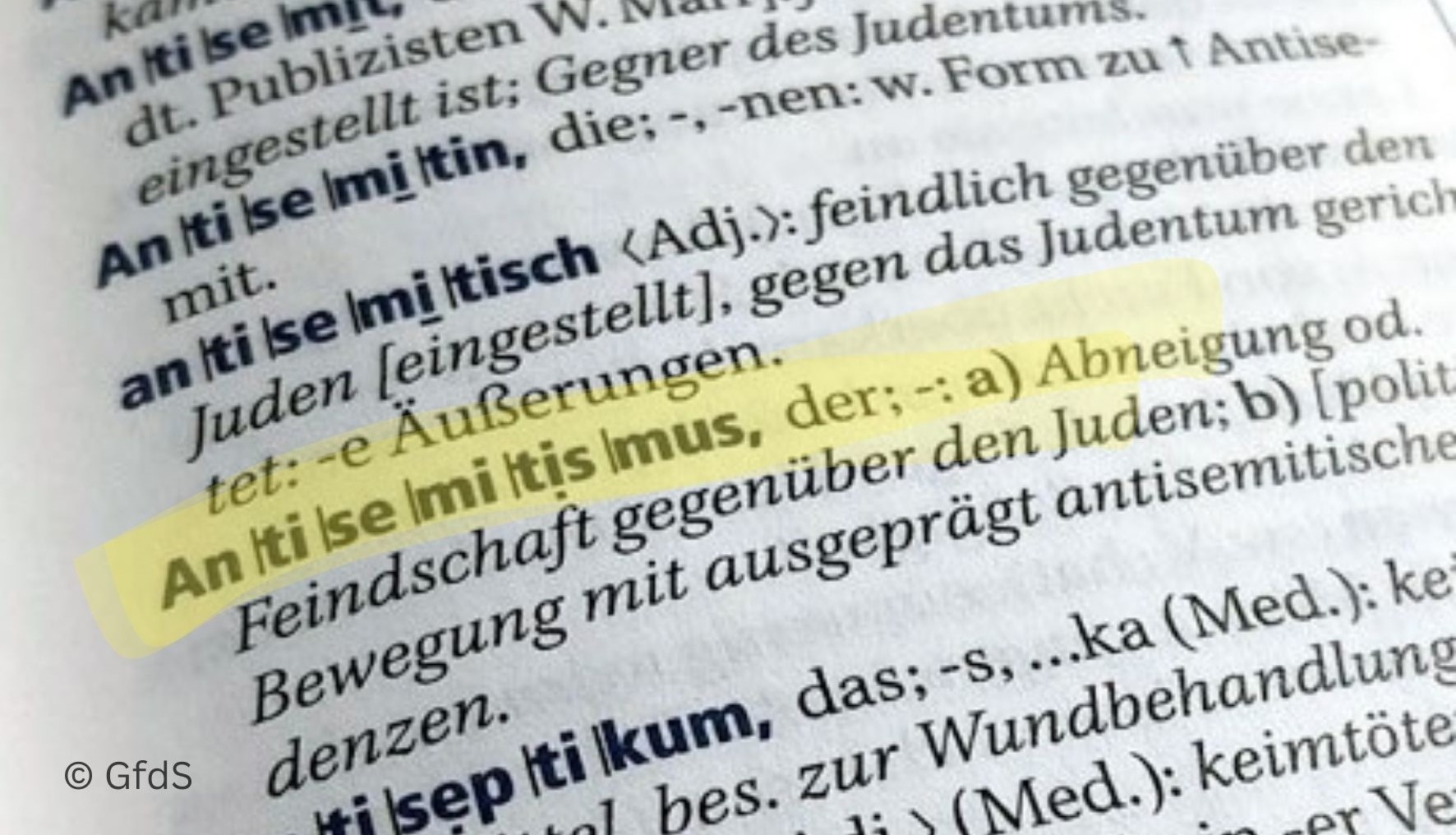„Danke! Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben.“ – Nach dem zweistündigen Gespräch legt Frau Y. auf. Ihrem Sohn Ben wurde in der Schule der Button mit dem Davidstern vom Rucksack gerissen, und er selbst als „Kindermörder“ beschimpft. Am Tag darauf rief seine Mutter bei uns an und suchte verzweifelt nach Unterstützung. Als Antidiskriminierungsberaterin bin ich für Frau Y. da, höre zu, kläre ihre Bedürfnisse und bespreche Handlungsmöglichkeiten. In diesem Fall wenden wir uns an den Schulleiter Herrn W., um eine Aufklärung der Situation und Maßnahmen gegen zukünftigen Antisemitismus zu fordern. Gelingt die Aufarbeitung mit Herrn W. nicht, nehmen wir in solchen Fällen Kontakt mit der nächsthöheren Stelle auf, um Druck auf die Täter:innen auszuüben. Ziel ist immer der Wunsch der Klient:innen. Das heißt: meine Arbeit ist parteilich. Und das ist sehr wichtig, denn gerade Betroffene von Antisemitismus fühlen sich, insbesondere bei israelbezogenem Antisemitismus, oft gegaslighted.
Eine der Herausforderungen bei der Beratung ist die Erreichbarkeit. Wie gestalten wir unser Angebot so, dass die Ratsuchenden uns finden und uns vertrauen? Wie werden wir ihren Bedürfnissen gerecht? Ein wichtiger Schritt ist es, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Beratung zu schaffen. Das bedeutet unter anderem, sich in dem Feld gut auszukennen und entsprechend Verständnis geben zu können. Wichtig dabei ist eine klar antisemitismuskritische Haltung der Berater*innen. Als Frau Y. zu uns in die Beratung kam, war klar, dass wir ihr und ihrem Sohn glauben, was ihm widerfahren ist. Gleichzeitig war es wichtig, den Angriff einzuordnen und in einen Kontext israelbezogener antisemitischer Vorfälle, die nach dem 7. Oktober 2023 stark zugenommen haben, zu setzen. Auch dass die Beratung auf Russisch stattfand, war ein wichtiger Punkt. Dass ich Russisch spreche, war ein großer Vorteil in dieser Beratung, denn obwohl Frau Y. gut Deutsch spricht, fiel es ihr deutlich leichter, ihre Gefühle auf Russisch auszudrücken.
Der Fall von Ben ist kein Einzelfall – der Antisemitismus in Deutschland und in NRW ist seit dem 7. Oktober 2023 massiv angestiegen. Das schlägt sich auch bei uns in der Beratung nieder. Allein die Anzahl unserer Beratungen hat zugenommen. Auch das Verhältnis zwischen Fällen von Rassismus und Fällen von Antisemitismus hat sich umgekehrt: waren 2023 knapp ein Drittel aller Fälle antisemitisch, so hat sich diese Zahl 2024 fast verdoppelt. Rund 40 Prozent aller Fälle finden dabei im schulischen Kontext statt. Immer mehr Fälle aus dem Bildungsbereich sind zudem dem israelbezogenen Antisemitismus zuzuordnen, etwa wenn Grundschulkinder auf einer aufgemalten Israelfahne auf dem Schulhof herumtrampeln und sie bespucken. Oder wenn der Lehrer eines Nachhilfeinstituts ohne erkennbaren Zusammenhang den sogenannten Nahostkonflikt „einordnet“.
Was konkret tun wir in der Beratung? Im ersten Beratungsgespräch hören wir uns zunächst an, was die Betroffenen erzählen möchten. Bei Unklarheiten stellen wir Nachfragen und versuchen so, ein umfassendes Bild des Vorfalls zu erhalten. Im zweiten Schritt geht es um die Bedürfnisse der Ratsuchenden. Diese werden im Laufe der Beratung immer wieder evaluiert und aktualisiert, sie stehen zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund unserer Arbeit. Wünscht die Person eine Aufklärung der Situation mit den Beteiligten, begleiten wir sie dabei. Oftmals ist auch ein Beschwerdebrief eine gute Möglichkeit, auf den diskriminierenden Vorfall aufmerksam zu machen und Maßnahmen einzufordern. Handelt es sich um eine Reihe sich wiederholender Fälle, arbeiten wir zunächst daran, diese zu beenden – sei es, indem wir die Verantwortlichen konfrontieren oder indem wir die Ratsuchenden aus der Situation herausbringen.
In 100 Prozent der Beratungsfälle bei SABRA wechselt das betroffene Kind die Schule. In 100 Prozent der Fälle bleiben die Täter*innen auf der Schule, oftmals ohne Konsequenzen zu tragen. So war es auch bei Ben. Nach zahlreichen E-Mails, Telefonaten und Gesprächen mit der Schule wurde deutlich, dass Ben keine Maßnahmen zu seiner Sicherheit von Seiten der Schule erwarten konnte. Die Täter hätten ihn in jeder Pause wieder angreifen können, ohne dass es ein Schutzkonzept gegeben hätte. Unsere Handlungsmöglichkeiten waren damit fast erschöpft, sodass wir die Familie dabei unterstützt haben, die Schule zu wechseln.
Ben und seiner Mutter haben wir in dieser Zeit bestmöglich geholfen. Das heißt, wir standen im dichtmaschigen Austausch mit ihnen, holten immer wieder den aktuellen Stand der Dinge ein und berichteten über aktuelle Handlungsschritte. Wir begleiteten zu Gesprächen mit den Beteiligten, klärten über Rechte auf, unterstützten in praktischer Hinsicht und hörten auch einfach nur zu. Gleichzeitig arbeiteten wir eng mit einer Opferberatungsstelle und der psychologischen Beratungsstelle OFEK zusammen. Während wir in die praktische Aufarbeitung einer Situation mit den Betroffenen gehen, unterstützt OFEK auf der emotionalen Ebene. Ebenso werden antisemitische Vorfälle bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS NRW gemeldet.
Nach dem 7. Oktober haben sich die Bedingungen unserer Arbeit nicht etwa verbessert. Durch den Anstieg an Beratungsfällen werden mehr Kapazitäten für die Beratung benötigt. Teilweise haben wir nun bis zu sieben offenen Fällen, an denen wir gleichzeitig arbeiten. Es melden sich andererseits auch oft Menschen bei uns, die wir weiterverweisen müssen – sei es, weil sie eine andere Beratung benötigen, nicht in NRW wohnen oder eine andere Diskriminierungsform als Antisemitismus oder Rassismus erlebt haben. Auch sind wir immer wieder Anrufen und Kontaktversuchen von Verschwörungstheoretiker*innen oder Reichsbürger*innen ausgesetzt, die potenziell auch ein Sicherheitsrisiko für uns darstellen. Zwar hat SABRA als Beratungsstelle noch keine gezielten Angriffe erlebt. Doch gerade in der letzten Zeit sind Veranstaltungen unserer Schwesternorganisation ADIRA in Dortmund immer wieder Ziel von vorsätzlichen Störungen geworden. So wurde etwa die Vorführung des Films „Screams before Silence“, in dem sexualisierte Gewalt der Hamas im Zuge des Terrorangriffs am 7. Oktober thematisiert wird, aus dem Umfeld des antiisraelischen Aktivismus gezielt gestört. Dies zeigt, wie vulnerabel unsere Arbeit ist und in welchem gesellschaftlich unwillkommenen Klima wir uns als Berater*innen gegen Antisemitismus bewegen. Auch dies ist ein Grund für die selten zufriedenstellenden Aufarbeitungen der Beratungsfälle.
Der 7. Oktober 2023 war ein großer Einschnitt in der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Die Beratung immer neuer und immer mehr antisemitischer Vorfälle erfordert Mut, Resilienz und Zähigkeit. Auch wenn es unter den aktuellen Bedingungen unwahrscheinlich scheint: wir arbeiten auf eine Welt hin, in der Ben auf den Schulhof treten kann und sich vor nichts fürchten muss. Egal, ob er einen Davidstern am Rucksack trägt oder nicht.
Katja Kuklinski
Das könnte Sie auch interessieren
SABRA ist neues Mitglied im EPNA-Netzwerk

Wir freuen uns, dass SABRA nun offiziell Teil des European Practitioners Network Against Antisemitism (EPNA) ist. Erste Kontakte zum Netzwerk bestehen seit Anfang 2025. Nun wurde die Zusammenarbeit vertieft. EPNA vernetzt…
Beitrag lesenWissen. Erkennen. Handeln.

Fachtag zu antisemitismuskritischer Jugendarbeit Wie kann man Antisemitismus in der Jugendarbeit entgegentreten und junge Menschen dazu empowern, sich dagegen einzusetzen? Unter dem Motto Wissen. Erkennen. Handeln fand unser sechster Fachtag…
Beitrag lesen